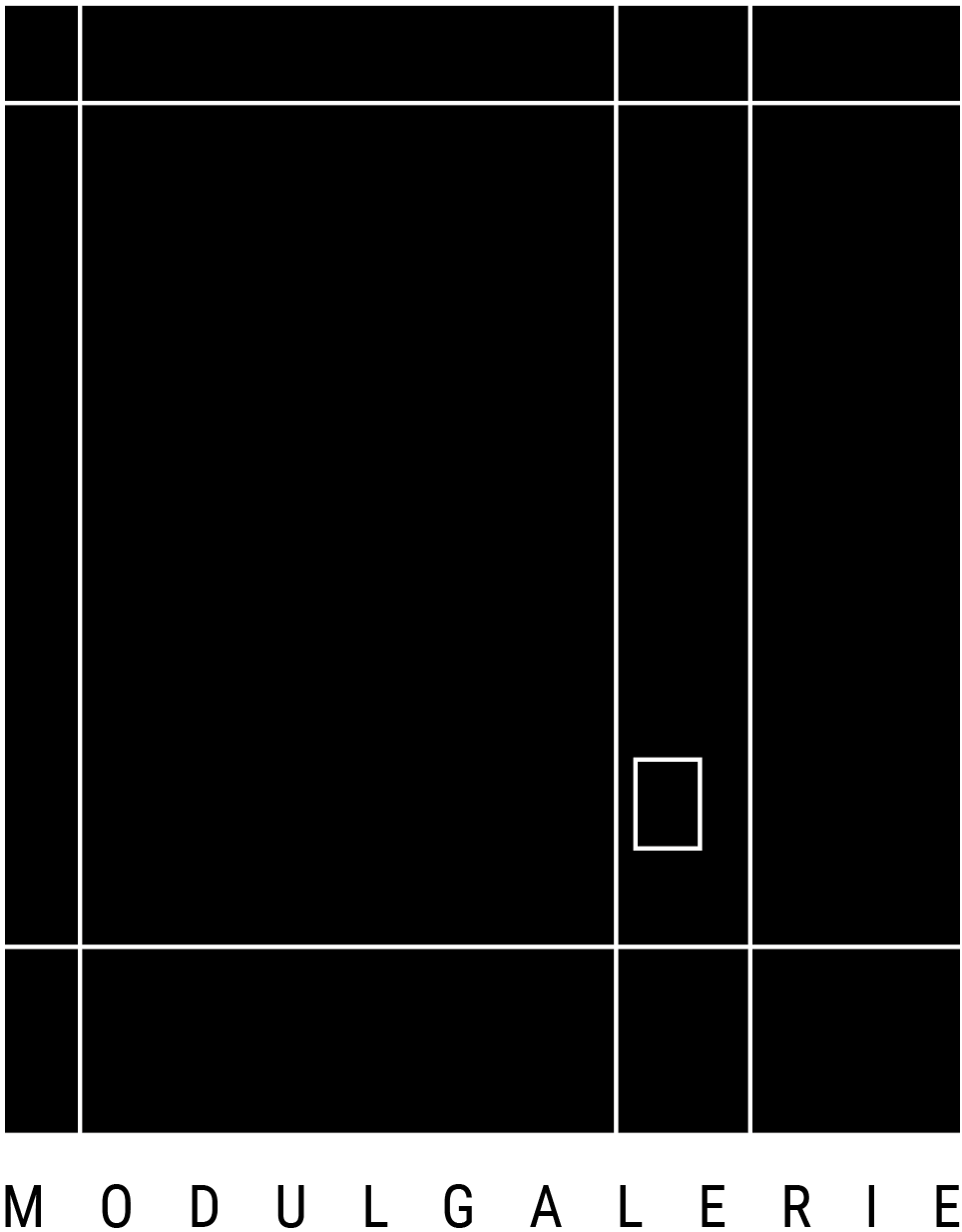Kunsthistorikerin
Susann Scholl
Modulgalerie – Kunst im Schließfach
Kunst im öffentlichen Raum ist sichtbar. Diese Eigenschaft gehört untrennbar zu ihr, seit sie sich in den 1970er-Jahren als Präsentationsform außerhalb des geschlossenen Museumsraums etabliert hat. „Kunst für alle“ – lautete der Schlachtruf, der verbunden war mit dem Wunsch der Kommunen, die Kunst von ihrem hohen Sockel mitten unter die breite Masse des Volkes zu heben. Seither schmücken Kunstwerke entweder als identitätsstiftende Elemente in den Straßen und Wohnvierteln, als Gedenkorte oder als weithin sichtbare Landmarken unsere Stadträume. Dass sich die Kunst im öffentlichen Raum versteckt, ist dagegen neu. Die Modulgalerie, die im Jahr 2021 in Nürnberg mit einer Präsentation von Kasia und Olaf Prusik-Lutz eröffnet wurde, gehört zu den leisen Kunstwerken, die man als kleines Juwel in der Stadt entdecken kann. Das Konzept beruht auf einer seit einigen Jahren zu beobachtenden künstlerischen Praxis, bei der vorhandene Strukturen und städtische Zusammenhänge in den Blick genommen werden. Die Modulgalerie ist auch weniger selbst Kunstwerk, als ein neuer Ort, der sich den Rahmenbedingungen der Kunst im öffentlichen Raum fügt: sie ist 24 Stunden am Tag für jeden kostenfrei zugänglich.
Hinter den Türen einer ehemaligen Gepäckaufbewahrung in einer zentralen U-Bahn-Passage der Stadt befinden sich 48 Fächer, die nun nicht mehr mit Taschen und Koffern, sondern im Turnus von vier Monaten mit Kunst gefüllt werden. Die vorgegebenen Räume sind klein; sie ähneln einer Miniaturtheaterbühne, hinter deren Vorhang (bzw. Metalltür) sich Inhalte entfalten können. Manchmal ergeben sich Zusammenhänge zwischen den Fächern, im Sinne einer visuellen Choreografie. Diese ist immer auch abhängig von der Aktion der Betrachtenden, ob sie die Türen einzeln nacheinander öffnen oder mehrere gleichzeitig. Die Künstlerinnen und Künstler müssen sich dem kleinen Maß anpassen, ihre häufig größer dimensionierten Werke den kleinen Räumen einfügen. Dafür übersteigen die technischen Möglichkeiten jede räumliche Grenze: von der Zeichnung, der Raumgestaltung, Objekten bis hin zu medialen Präsentationen oder Klanginstallationen ist alles denkbar. Das Konzept baut hier nicht nur auf die Entdeckerfreude bei den Betrachterinnen und Betrachtern, sondern auch auf die den meisten Menschen angeborene Freude am Sammeln, am Zusammentragen von Formen, Inhalten und Informationen.
Das aktuelle Ausstellungsprojekt Treibstoff, das acht Künstlerinnen und Künstler aus Nürnberg (D), Krakau (PL) und der Charkiw (UA) zusammenbringt, und jeder/m gleichberechtigt sechs „Schauplätze“ zuweist, spielt mit dem Wechsel der künstlerischen Positionen, dem Wiedererkennen der bei allen klar lesbaren Handschriften und der inhaltlichen Bezüge, die sich durch das Nebeneinander ergeben. Sie nimmt dabei die Lust am Sehen und Entdecken zur Grundlage. Besonders augenfällig greifen die Arbeiten von Justyna Smoleń diese Thematik auf: Ausgestellt sind Porzellanfiguren, wie man sie seit dem 18. Jahrhundert als bürgerlichen Dekor kennt. Sie stehen nun in den ehemaligen Gepäckfächern wie Schauobjekte in kleinen Vitrinen. Allerdings sind die Figuren verändert: An Bruchstellen wurden sie zu neuen Formen zusammengekittet, wodurch sich absurde Verbindungen und Konstellationen ergeben haben. Spiel und Schmerz liegen hier nah beieinander.
Dass in der aktuellen Situation Kunstschaffende aus Ländern zusammenkommen, die zwar europäische Partnerstädte sind, in denen die Bedingungen aber, unter denen die Kunst entsteht, eine völlig andere ist, ist nicht selbstverständlich und auch mit der Gefahr verbunden, dass die Bedeutungen der gezeigten Werke in einer unverhältnismäßigen Beziehung zueinander stehen. Das Nebeneinander gelingt durch die gleichwertige Präsentationsform, als auch durch das gewählte Thema: „Was bedeutet es für die Menschheit, wenn die maximale Ausbeutung der Zeit erfolgt? Wenn die Dichte der Ereignisse, die Geschwindigkeit der Informationen, die überfüllte virtuelle Welt vor Überlastung explodieren?“ (Maria Varlygina) Der Treibstoff, der unsere Welt zusammenhält, ist für alle ein elementares Thema, dessen Gewicht aktuell schwer wiegt. Die in Charkiw mitten im Krieg lebenden Künstler Konsiantyn Zorkin und Vladyslav Yudin arbeiten mit Holz (Zorkin) und Seil, Stein oder Ton (Yudin) – natürlich vorkommende Materialien, die in ihren naturgegebenen dunklen Farbtönen belassen werden. Während Zorkin aus Holz geschnitzte Hände zeigt, aus denen Formen erwachsen – manchmal zarte Pflanzen und Tiere, manchmal scharfe Krallen –, greift Yudin die traditionelle ukrainische Glückspuppe, die Motanka, auf. Sie ist hier aber keinesfalls der buntgeschmückte Talisman, sondern rau, fast schon ärmlich und zu schmerzhaften Posen arrangiert. In der Art, wie sie präsentiert sind, drücken sie nicht nur das Einfache aus (man hat die Menschen vor Augen, die diese Glückspuppen als Schätze in ihren Taschen tragen), sondern lassen auch die Schrecken von Gewalt und Tod anklingen.
In Dashdemed Sampils Werken zeigt sich das Raue, Haptische in Form von quaderförmigen Steinen, die bei ihm im Kontrast zu einer digitalen Welt stehen. Auf mehreren Displays entwickeln sich völlig freie Formen, denen etwas sehr Lebendiges innewohnt und die auf eine uns unverständliche Weise miteinander kommunizieren. Sind es Wesen, die uns eine andere Welt vorführen? Eine Welt, wie sie sich Adam Cmiel möglicherweise als Alternative vorstellt: ein bisschen mystisch-verwunschen und vom Lärm der restlichen Welt abgeschottet. In seinen Installationen, die in rötliches Licht getaucht etwas Hoffnungsvolles ausstrahlen, taucht der Mensch nur noch indirekt über ein heimeliges Dekor auf, das in der Zusammenstellung allerdings Rätsel aufgibt.
Neben der Besinnung auf das Natürliche ziehen sich Zitate des Volkstümlichen durch die Ausstellung. Marta Jamrógs Bildtafeln und Objekte zitieren die traditionelle Ikonenmalerei und heben damit das dargestellte Thema – die unverhältnismäßige Beziehung zwischen Mensch und Tier – auf eine religiös-bedeutungsvolle Ebene. Für die Darstellungen wählt sie den Stil der naiven Malerei, und greift so für den Wunsch nach Aussöhnung zwischen den Lebewesen bewusst auf eine traditionelle Malerei zurück. Somit reagiert Treibstoff auf eine aus dem Gleichgewicht geratene Welt, in der die Tradition als möglicher Anker angeboten wird. Es bleibt zu wünschen, dass mehr Passant*innen sich Zeit nehmen, diesen besonderen Ort zu entdecken, denn in der täglichen Hektik wird der unaufdringlich schwarzlackierten Galerie noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Susann Scholl